Du nimmst Dich immer mit
Wenn Menschen sich entscheiden, ihrem Berufsleben eine neue Wende zu geben, lohnt sich der kritische und selbstkritische Blick zurück: auf erfüllte und unerfüllte Erwartungen, den eigenen und den fremden Beitrag dazu und Lehren, die daraus erwachsen für die Suche nach der neuen Aufgabe und dem neuen Arbeitgeber. Management-Berater Reinhard K. Sprenger gibt im Gespräch mit Annette Eicker ein paar Gedankenanstöße für die schonungslose Analyse des eigenen Stand-Punkts.
Wenn wie jetzt die Konjunktur gut läuft, gibt es einen starken Zuwachs an Jobofferten – nicht weil so viele neue Stellen entstehen, sondern weil die Wechselbereitschaft stark steigt. Warum werden aktuell so viele Arbeitgeber abgewählt?
Die Gründe für die individuelle Veränderungsbereitschaft liegen entweder darin, dass sich etwas von innen verändert hat oder von außen. Innere Gründe können zum Beispiel sein, dass man sich dereinst mit der Wahl seines Berufes vertan hat. Leider treffen viele Menschen die Entscheidung über ihre berufliche Situation in relativer Bewusstlosigkeit. Da kam irgendwann der Papa um die Ecke mit einem Zeitungssauschnitt „Wie wäre es denn mal mit Apotheker?“ und schwups wirst Du Apotheker. Oder man braucht gerade Ingenieure, also wirst Du Ingenieur. Oder weil es hochreputierlich ist, wirst Du eben Arzt. Und dann bleibst Du sehr lange auf dieser Schiene, weil man ja auf Sicherheit setzt. Irgendwann im Laufe des Lebens wird dann aber klar: In dem, was ich da mache, liegt gar nicht mein Talent. Das ist dann im Alltag unwahrscheinlich anstrengend, denn man muss immer gegen innere Widerstände ankämpfen. Deshalb ist eine der Fragen, die ich mir immer stellen würde: Fällt Dir das, was Du tust, leicht?
Aber auch bei wohlüberlegter Berufswahl kann ja die Situation eintreten, dass ich nicht richtig weiterkomme.
Das ist oft der Fall, wenn die Lernkurve fällt: Du machst etwas vielleicht sehr erfolgreich, aber Du lernst immer weniger und weniger. Es wird also immer langweiliger und das Gefühl kommt auf: „Ich mach das schon zu lange!“. Dann wird die Neugier-Aktivität des Menschen nicht mehr befriedigt. Die ist eine anthropologische Konstante, denn das Lernen-wollen und das Sich-herausfordern im Tun ist Voraussetzung für motiviertes Handeln. In dem Moment, in dem ich das nicht mehr habe, sacke ich weg. Wenn ich also auf einem Job sitze, wo ich nur noch meine Routine abfackle, bin ich nicht mehr mit ganzer Liebe dabei. Da kommt es dann von innen, dass jemand sagt: „Ich muss was Neues machen!
Welchen Anteil habe ich selbst daran, wenn meine Motivation nachlässt?
Einen großen. Wer sagt, ich muss den Arbeitgeber wechseln, um etwas zu verändern, läuft in den gleichen Irrtum wie der, der sagt, ich will in ein anderes Land gehen, um glücklich zu werden. Du nimmst Dich immer mit. Und dann bist Du im neuen Job, wachst morgens auf und liegst wieder neben Dir. Wer denkt, er muss nur die äußeren Rahmenbedingungen ändern, irrt, denn er ignoriert die alles tragende Voraussetzung: Das Entscheidende bist Du mit Deinen inneren Einstellungen. Wenn Du jemand bist, der immer nur die Löcher im Käse sieht, dann kann man Dir das Paradies auf Erden auf den Bauch binden, Du wirst immer nur die Löcher im Käse sehen und das, was fehlt.


Also sollte man die Erwartungen an einen Arbeitgeberwechsel nicht so hoch hängen?
Wenn ich mein Lebensglück definieren will, geht es immer um die gleichen drei Fragen: Erstens, beschäftige ich mich mit dem richtigen Gegenstand, zweitens mit den richtigen Leuten, drittens am richtigen Ort? Anders gesagt heißt die zentrale Frage, die ich mir stellen muss: Bekomme ich für das, was ich am besten kann, auf dem Spielfeld, auf dem ich bin, auch ein Lächeln? Oder beutet dieses Spielfeld nur ein Zweit- und Dritt-Talent von mir aus, wo ich vielleicht ganz gut bin, aber nicht zu den Besten zähle?
Die allermeisten Menschen, die ich kenne, sind sehr leistungsbereit und sehr leistungsfähig, aber sie haben sich in der Wahl des Spielfelds vertan, das heißt, sie kriegen da, wo sie sind, die PS nicht auf die Straße. Und das hat natürlich mit Unternehmenskultur im weitesten Sinne etwas zu tun. Allerdings ist mir das Wort Unternehmenskultur zu groß. Ich würde mich fragen: Bin ich richtig in der Nachbarschaft von einem bestimmten Chef, bestimmten Kollegen und einer bestimmten Aufgabe? Vielleicht habe ich mich ja in der Wahl der Nachbarschaft vertan.
Wenn ich am Sonntagnachmittag an Montagmorgen denke, mit welchem Gefühl denke ich daran? Freue ich mich, dahin zu gehen oder denke ich „Um Gottes willen, das muss ich überhaupt nicht haben“. Wenn ich darunter richtig leide, muss ich handeln, das ist gar keine Frage. Allerdings muss ich auch in der Lage sein, im Rahmen des menschlich zumutbaren mit Defiziten zu leben. Und die Defizite werden nicht besser im nächsten Job. Man muss sich selbst fragen: Suche ich immer das Haar in der Suppe?
Welche Rolle spielt denn das Unternehmen mit seiner Eigenidentität für das Frustpotenzial?
Kein Zweifel: Organisationen führen ein Eigenleben, denn sie müssen sich ja permanent von Nicht-Organisation und von anderen Organisationen abgrenzen. Sie fangen dann an, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ihre Existenzberechtigung immer wieder unter Beweizu stellen. Und da gibt es natürlich jede Menge scheinbar sachlogische und rationale Vorgehensweisen. Das sind alles nette Sachen, die nenne ich immer afrikanische Regentänze. Bei denen kommt ja auch kein Regen, aber tanzen muss man. Man tanzt mit, aber darf nicht glauben, dass diese Tänze tatsächlich erreichen, was sie vorgeben zu erreichen.
Der wesentliche persönliche Kampf ist der, dass man verhindern muss, dabei zynisch zu werden. Wenn man von einer tiefen moralischen Wurzel her bestimmt wird, dann muss ja alles immer rational sinnvoll und ergebnisorientiert sein. Ist es aber nicht. Die Organisation dreht sich um sich selbst. Da muss man dann mitspielen und gewissermaßen trotz dessen etwas rational Kluges machen. Wenn man zynisch wird, ist es besser, das Unternehmen zu verlassen.
Welche Rolle spielen Führungskräfte als Grund für den Wechselwillen vieler Mitarbeiter?
Da gibt es ein ehernes Gesetz: Menschen kommen zu Unternehmen, aber sie verlassen Vorgesetzte. Das heißt: Attraktiv ist das Blinken der Marke, des Unternehmensnamens, aber dann scheitert die Zusammenarbeit auf der Mikroebene. Das heißt, es ist ein Beziehungsproblem.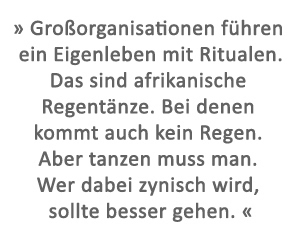
Ob eine Führungskraft erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, ist ganz schwer zu beurteilen. Aber was man sehen kann, ist, ob sie die Herzen erreicht, ob gute Leute mit der Person arbeiten wollen oder nicht. Wenn eine Unternehmenseinheit im Geschäft nicht gut abschneidet, muss das nicht zwangsläufig mit der Führungskraft zusammenhängen. Aber wenn eine Führungskraft gute Leute verliert, dann kann das nur an ihrem Führungsstil liegen.
Und wenn Unternehmen dann viel Geld in das sogenannte Employer Branding investieren, aber nicht gleichzeitig die Bereitschaft ihrer Führungskräfte optimieren, warme emotional-soziale Beziehungen aufzubauen, dann erhöhen sie nur die Transaktionskosten, können also das Geld besser gleich verbrennen. Was nutzt es, wenn die Makroebene anzieht, die Leute aber auf der Mikroebene wieder nach Hause gejagt werden. Und wir wissen ja, dass gerade viele gute, engagierte Leute schon nach zwei Jahren nicht mehr mit ganzem Herzen dabei sind, weil ihre Erwartungen enttäuscht wurden.

Genauso viel Geld wird investiert in Mitarbeiterbindung und sogenannte Retention-Programme. Was bringt das?
Das ist pervers. Wenn Menschen gehen wollen, dann haben sie dafür Gründe. Und die sollte man nicht versuchen zu unterlaufen, indem man ihre Rationalität aushebelt mit goldenen Ketten und Karriereversprechen. Das ist genauso, als ob im Privatleben mein Partner nur bei mir bleibt, weil er es sich finanziell nicht erlauben kann, mich zu verlassen. Würdeloser geht es ja wohl nicht. Es sollte mich interessieren, warum er weg will. Das herauszufinden, wäre ein kluger Umgang damit.
Vielfach geht es aber beim Jobwechsel auch um die Idee, sich anderenorts besser verwirklichen zu können.
Diese Idee von der Selbstverwirklichung finde ich sehr problematisch, um nicht zu sagen ziemlich unerträglich. Ich glaube nicht an die Idee von einem „Selbst“, das ist ein Konstrukt. Und es ist die fundamental-ontologische Einladung zur Unzufriedenheit, denn man selbst wird sich ja nie verwirklichen. Und ich möchte das auch nicht, weil ich glaube: Es gibt Aufgaben, es gibt Selbstverpflichtung, es gibt Verantwortung. Das sind wichtige Dinge. Ich spiele meine Rollen und habe meine Geschichte, und wenn ich in den Spiegel gucke und sage „Ich“, dann meine ich meinen Körper. Alles andere ist eine metaphysische Überhöhung.
Wichtig ist, sich die inneren Aspekte anzugucken: Bin ich auf dem richtigen Spielfeld? Viele Leute 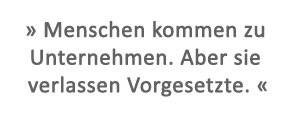 brauchen nur ein bisschen Mut, auf die andere Straßenseite zu wechseln. Dadurch kann aus einem mediokren Performer ein Top-Performer werden, weil das, was in dem vorherigen Kontext nicht gewollt war, hier plötzlich gewollt ist. Aber dazu muss man natürlich mal ein bisschen den Hintern hochkriegen.
brauchen nur ein bisschen Mut, auf die andere Straßenseite zu wechseln. Dadurch kann aus einem mediokren Performer ein Top-Performer werden, weil das, was in dem vorherigen Kontext nicht gewollt war, hier plötzlich gewollt ist. Aber dazu muss man natürlich mal ein bisschen den Hintern hochkriegen.
Wie kann ich durch Employer Branding-Versprechen hindurch gucken und herausfinden, ob mein Verständnis von Arbeit und Führung in das Unternehmen passt, bei dem ich mich bewerbe?
Gar nicht. Das kann ich vorher nicht wissen. Meistens ist man ja geneigt, den Interviewer oder das, was man in einem Assessment-Center erlebt, als typisch für die nicht erfahrbaren Elemente eines Unternehmens zu nehmen. Und meistens liegt man damit falsch. Menschen arbeiten nicht in einem Unternehmen, sondern in Nachbarschaften, die von einem Chef definiert werden, von ein paar Kollegen und so weiter. Ich glaube, es ist klug, erstmal davon auszugehen, dass das Thema Passung wichtig ist. Also: Passe ich zur Aufgabe? Passe ich zu den Menschen? Und dazu ist es klug, sich seine Kollegen und seinen Chef anzugucken, bevor man ja sagt.
Zweitens finde ich es sehr, sehr sinnvoll, die wichtigste personaldiagnostische Situation zu nutzen, die dummerweise niemand nutzt: Die Probezeit. Die empfiehlt es sich, wechselseitig zu nutzen: Passe ich zu euch, passt ihr zu mir? Und das bedeutet, die erfolgskritischen Situationen in der Probezeit wirklich zu prüfen, also seriös vorzubereiten, seriös zu begleiten, seriös auszuwerten, um am Ende der Probezeit „Ja“ zu sagen zu der Situation oder „Nein“. Das macht aber niemand. 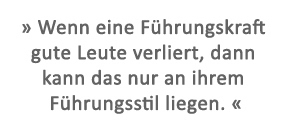
Wenn ich „Ja“ sage: Wie lange sollte ein solches Commitment denn tragen in einer Zeit, in der es eigentlich keine langfristigen Commitments auf Seiten der Unternehmen und der Mitarbeiter mehr gibt?
Wenn ich „Ja“ sage, ist das heute ein „Ja" mit mittlerer Reichweite. Und das ist auch gut so, denn Entscheidungen werden unerträglich, wenn man sich mit Ewigkeitswerten herumquält. Ich denke, es ist gut, Entscheidungen zu fällen mit Blick auf das Ende und einfach mal zu sagen „Ich mach das mal fünf Jahre und dann entscheide ich neu“. Und das meine ich nicht als fiktive Zahl, sondern wirklich wörtlich: fünf Jahre. Danach kann man bereit sein, zu verlängern, aber es ist nicht selbstverständlich.
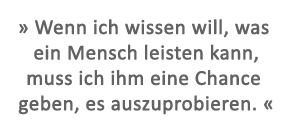 Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass gemeinsame Wege beginnen und gemeinsame Wege auch enden. Das ist für beide Seiten fair. Die Karriereleiter, die das Unternehmen und das Individuum viele Jahrzehnte verband, ist ja weggebrochen. Und das hat ja auch was Gutes, denn es heißt: Ich muss die Sinnhaftigkeit meines Tuns nicht aus der Jetztwelt-Abschaffung nehmen – „Morgen beginnt das Leben, wenn ich diese Position erreicht habe“ –, sondern ich kann die Energie aus der Gegenwart nehmen, aus dem Tun.
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass gemeinsame Wege beginnen und gemeinsame Wege auch enden. Das ist für beide Seiten fair. Die Karriereleiter, die das Unternehmen und das Individuum viele Jahrzehnte verband, ist ja weggebrochen. Und das hat ja auch was Gutes, denn es heißt: Ich muss die Sinnhaftigkeit meines Tuns nicht aus der Jetztwelt-Abschaffung nehmen – „Morgen beginnt das Leben, wenn ich diese Position erreicht habe“ –, sondern ich kann die Energie aus der Gegenwart nehmen, aus dem Tun.
Das heißt aber auch, dass ich danach noch mal andere Talente ausleben kann. Wirtschaft ist ja so flexibel geworden, dass wir – provozierend gesagt – heute alle Zeitarbeiter sind. Die meisten haben es nur noch nicht kapiert. Und ich bin ein großer Befürworter der Zeitarbeit, denn heute sind Berater, Piloten, Ärzte, Journalisten freiwillig und gerne Zeitarbeiter. Ein fester Job ist eine Illusion. Und ich glaube, wir sollten lernen, das auch als Illusion anzuerkennen.

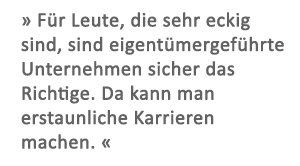
Washalten Sie von den gängigen Methoden, mit denen in Unternehmen die Potenziale von Bewerbern evaluiert werden?
Das ist Unfug. Es folgt der alten freudianischen Idee von der Analysefähigkeit der Persönlichkeit, dem Gedanken der Potenzialanalyse. Organisationen brauchen Testverfahren und Assessment-Center, um sich selbst zu vergewissern und als Rituale, um irgendwie mit dem Thema klarzukommen. Das ist einer der berühmten afrikanischen Regentänze.
Inhaltlich ist es aber reine Kaffeesatzleserei. Da kann ich genauso festlegen, ich nehme die Blonde oder den Rothaarigen. Natürlich entwickle ich eine implizite Hypothese, ob eine Person eine Aufgabe bewältigen kann oder nicht. Aber diese Verfahren bringen keine Sicherheit über die Passung eines Menschen.
Und was ist dann das Mittel der Wahl?
Wenn ich wirklich wissen will, was ein Mensch leisten kann, muss ich ihm die Chance geben, es auszuprobieren. Das heißt, ich muss Menschen in Situationen bringen, in denen ich sehen kann, ob sie sich in ein Vakuum hinein ausbreiten. Ich muss also Bedingungen schaffen in der Organisation, die ermöglichen, dass Leute sich austesten, muss ihnen ein Projekt geben oder eine kleine Führungsaufgabe, dann sehe ich, ob es klappt oder nicht. Das ist das einzige seriöse Verfahren. Ich weiß also immer erst im Nachhinein, ob jemand Potenzial hatte. Vorher kann ich das nicht wissen. Genauso weiß ich als Mitarbeiter auch erst im Nachhinein, ob ich Talent habe, irgendetwas zu tun.
Gibt es eine Korrelation zwischen einer guten Führungskultur und der Größe eines Unternehmens?
Ja, Größe ist wichtig. Und ja, es gibt eine Korrelation, aber keine Kausalität. Größe ist für das Thema Vertrauen absolut nachteilig. Je größer ein Unternehmen, desto geringer der Vertrauenspegel. Und Größe hat immer die Tendenz zur Talentverschwendung. Größe macht zudem das Gefühl „Es kommt auf mich an“ schwierig. Kleine Strukturen kommen uns Menschen entgegen. Anthropologisch haben wir über Jahrtausende überlebt in Gruppengrößen von 50 bis 100 Leuten und nicht größer. Aber auch der einsame Wolf ist nicht das Modell, denn wir sind alle auf unsere Herde angewiesen. Das sollten wir auch nicht ganz ignorieren.
Und welche Bedeutung haben die Eigentumsverhältnisse als Kriterium bei der Arbeitgeberwahl?
In eigentümergeführten Unternehmen hat man eine große Chance, erstaunliche Karrieren zu machen. Für Leute, die ganz besondere Fähigkeiten haben, die sehr eckig sind, sehr besonders, sind eigentümergeführte Unternehmen sicherlich das Richtige. Tendenziell konsensfähige Menschen, die ein politisches Talent haben und geeignet sind, mit vielen Leuten klarzukommen, haben es in großen Kapitalgesellschaften leichter. Es gibt in kleineren Familienunternehmen auch noch die Vorteile organisatorischer Rückständigkeit, denn sie sind noch nicht so vollkommen von festen Instrumenten und Bürokratie dominiert und haben daher mehr Räume für den Menschen, der das füllen kann. In Großunternehmen müssen Menschen oft nur noch das tun, was die Organisation gleichsam als ungeregelt übrig gelassen hat. Die allgemeine Verherrlichung von Familienunternehmen halte ich allerdings für problematisch. Viele Unternehmer scheitern an der letzten unternehmerischen Herausforderung – der Übergabe. Dynastisches Denken und ökonomisches Prinzip gehen selten gut zusammen.
Interview: Annette Eicker

